(London / Großbritannien) – Afrika werde in den nächsten fünf Jahren mit voraussichtlich 41 Projekten zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Markt für grünen Wasserstoff. Führend seien die nordafrikanischen Staaten, darunter Ägypten, Algerien und Marokko: Die ganzjährig nutzbare Solare- und Windenergie böten reichlich Möglichkeiten für Investitionen in die Produktion des Energieträgers und die Exportinfrastruktur.
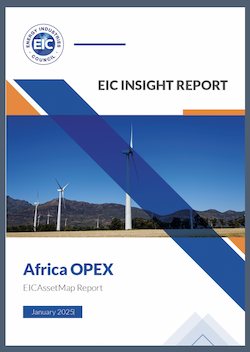
Africa OPEX Report 2025 des in London ansässigen Wirtschaftsverbandes Energy Industries Council (EIC). © EIC
Die Länder lägen strategisch günstig, um gemeinsam mit Europa den SoutH2-Korridor zu entwickeln, eine mehr als 3.300 Kilometer lange Pipeline, die Deutschland, Österreich und Italien einst mit jährlich vier Millionen Tonnen grünem Wasserstoff versorgen soll (wir berichteten). Allein Ägyptens nationale Wasserstoffstrategie ziele darauf ab, bis 2050 einen Anteil von acht Prozent am globalen Wasserstoffmarkt zu halten und jährlich zehn Millionen Tonnen zu produzieren, wobei ein erheblicher Teil für den Export bestimmt sei. Dies sind einige der Kernaussagen des neuen „Africa OPEX Report 2025“, ausgearbeitet vom Energy Industries Council (EIC), dem eigenen Angaben zufolge über 950 Mitglieder der Energiebranche angehören.
Länder müssen jetzt handeln
Der EIC warnt jedoch, dass der Wasserstoffsektor in Afrika „trotz seiner vielversprechenden Aussichten vor ernsthaften Herausforderungen steht“, darunter die Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen und Aufbau einer stabilen Infrastruktur. „Obwohl die längerfristigen Aussichten für den Wasserstoffsektor positiv sind, hat noch kein Projekt im kommerziellen Maßstab eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen“, sagt Neil Golding, EIC-Direktor für Marktbeobachtung: „Es müssen Abnahmeverträge unterzeichnet und eine Nachfrage geschaffen werden, damit die Projekte wirtschaftlich rentabel sind.“
Es sei klar, so Golding, „dass Nordafrika gut positioniert ist, um Europas Wasserstoffambitionen zu unterstützen, und dass es in Zukunft ein potenziell bedeutender Lieferant werden könnte“. So gebe es denn auch von der EU finanzielle Unterstützung für der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette – etwa für Namibia und Südafrika –, was „auf positive Aussichten für den Sektor“ hindeute.
Fruchtbarer Boden für grünen Wasserstoff
Denn Afrikas große Ressourcen bei Sonne und Wind sowie niedrige Produktionskosten böten „einen fruchtbaren Boden für die Ausweitung der Herstellung von grünem Wasserstoff“. Die 2022 ins Leben gerufene Africa Green Hydrogen Alliance, die von Ägypten, Kenia, Mauretanien, Marokko, Namibia und Südafrika angeführt werde, ziele darauf ab, den Kontinent „als weltweiten Vorreiter in diesem Sektor zu positionieren“.
Dem Bericht zufolge entwickele Afrika südlich der Sahara ebenfalls Kapazitäten für grünen Wasserstoff, wobei Länder wie Namibia führend seien. Ein dortiges 10-Milliarden-Dollar-Vorhaben werde 15.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe und 3.000 Dauerarbeitsplätze schaffen. Weiter nördlich, in Mauretanien, sollen die Projekte „Aman“ und „Nour“ Wasserstoff erzeugen.

CWP Global trat im Oktober 2024 einem Konsortium bei, zu dem unter anderem auch das Nürnberger Infrastrukturunternehmen Gauff gehört, um in Angola ein 600-MW-Wasserstoffprojekt zu entwickelt. Das Wasserstoffportfolio des Unternehmen besteht derzeit den Angaben zufolge aus acht Projekten in Afrika, Australien, Südamerika und Nordamerika mit einer Kapazität von kumuliert 200 Gigawatt, darunter die PtX-Projekte in Afrika in Mauretanien (Aman), Djibouti (Hayyu) und Marokko (Amun). Die Konsortialpartner v.l.: Stefan Traumann (Deutscher Botschafter in Luanda, Angola), Mike Scholey (CEO für Wasserstoff, CWP Global), Julian Reichert (Leiter Projektentwicklung, Conjuncta) , Stefan Tavares Bollow (Geschäftsführer, Gauff Engineering), Orlando da Mata (PCA, CPD-Sonangol), Vladimir Machado (CEO, CPD-Sonangol) © Gauff GmbH & Co. Engineering KG
Für das „Aman“-Projekt etwa hatten die Regierung von Mauretanien und CWP Global im Jahr 2022 eine Vereinbarung getroffen, wonach der in Belgrad ansässige Projektentwickler eine Produktionsstätte für grünen Wasserstoff mit einer Leistung von 30 Gigawatt in den Regionen Dakhlet Nouadhibou und Inchiri im Westen des Landes untersucht. Dazu gehören den seinerzeitigen Angaben zufolge auch die Installation von Windkraftanlagen (15 Gigawatt) und PV-Kraftwerke (15 Gigawatt) für den erforderlichen grünen Strom. In Angola will CWP im Rahmen eines Konsortiums, dem das Unternehmen im Oktober 2024 beitrat, eine Wasserstoffproduktion von 600 Megawatt aufbauen, die von Wasserkraft gespeist wird.
Die Vorlaufkosten für grüne Wasserstoffprojekte erforderten laut EIC-Bericht internationale Zusammenarbeit und Finanzierungsinitiativen. Der europäische REPowerEU-Plan, mit dem die Abhängigkeit des Kontinents von russischem Gas verringert werden solle und der darauf abziele, jedes Jahr zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff aus Afrika zu importieren, sei „ein Zeichen dafür, dass bereits Anstrengungen unternommen werden“. Allerdings sei eine „gezieltere Finanzierung und Zusammenarbeit der Schlüssel für die Ausweitung der Wasserstoffproduktion“ in Afrika.
Wasserstoffmarkt verbunden mit EE-Wachstum
Damit Unternehmen aus Europa und anderen Ländern nach Afrika gingen, müssten „die richtigen regulatorischen und finanziellen Bedingungen herrschen, die das Wasserstoff- und Cleantech-Potenzial Afrikas fördern“, sagt Rebecca Groundwater, Leiterin der Abteilung Externe Angelegenheiten des EIC. Der grüne Wasserstoffsektor sei eng mit dem allgemeinen Wachstum der erneuerbaren Energien in Afrika verknüpft.
Derzeit seien auf dem gesamten Kontinent Solaranlagen mit einer Leistung von 11,2 Gigawatt sowie 9,9 Gigawatt Windkraftanlagen installiert. Nimmt man Wasserkraft hinzu (40 GW), gibt es Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Leistung von kumuliert 61,1 GW, heißt es auf Anfrage. Südafrika sei mit 59 Solarparks führend bei der Solarkapazität, während nordafrikanische Länder wie Ägypten und Marokko die Entwicklung der Windenergie vorantrieben und damit bis 2024 Strom mit einer Leistung von neun Gigawatt in das Netz einspeisten.
Energiespeicher erforderlich
Allerdings müsse der Kontinent parallel zur Produktion auch in die Energiespeicherung investieren, so der Bericht. Die Kapazität sei von 180 Megawatt im Jahr 1979 auf 4,2 Gigawatt im Jahr 2023 gestiegen; davon 3,6 Gigawatt in Südafrika. „Der Sektor steht jedoch vor großen Herausforderungen, da es an klaren Vorschriften mangelt“, weiß man beim EIC.
Im Jahr 2024 wurden demnach Solaranlagen mit einer Leistung von 424,3 Megawatt sowie 821 Megawatt Windkraftwerke zugebaut; größtenteils in den nordafrikanischen Ländern und Südafrika. Afrika müsse zwischen 2026 und 2030 jährlich 190 Millionen Dollar investieren, um zu gewährleisten, dass der Sektor der erneuerbaren Energien weiterhin floriere, zitiert der Council die Internationale Energieagentur.
Doch kam es beim Energiewachstum offenbar zu einer Verschiebung. So sei im vergangenen Jahr die gleiche Anzahl von Projekten sowohl im Bereich der erneuerbaren Energien als auch im Öl- und Gassektor in Auftrag gegeben worden – angetrieben durch die Notwendigkeit, 600 Millionen Menschen überhaupt Zugang zu Strom zu verschaffen: 43 Prozent der Gesamtbevölkerung Afrikas.
Der „Africa OPEX Report 2025“ über die traditionellen und neuen Energiesektoren kostet für Nicht-EIC-Mitglieder 195 britische Pfund (zzgl. Mehrwertsteuer). Eine kurze Zusammenfassung gibt es kostenfrei.
Foto oben
Die Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) ist schon seit vielen Jahren in Afrika aktiv. Das Bild zeigt die „Sheikh Zayed“-PV-Anlage in der Hauptstadt Nouakchott der Islamischen Republik Mauretanien, die im Frühjahr 2013 in Betrieb genommen wurde – seinerzeit ein Meilenstein. Das 15 Megawatt leistende Kraftwerk machte damals laut Masdar zehn Prozent der Energieerzeugungskapazität des Landes aus. © Masdar / Clement Tardif






