Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst
+++++

Enertrag startet während der Messe „E-World 2025“ eine Auktion für 500 Tonnen grünen Wasserstoff. © Enertrag SE
(Deutschland) Enertrag SE hat eine Auktion für 500 Tonnen grünen Wasserstoff gestartet. In Osterweddingen bei Magdeburg entsteht derzeit eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von zehn Megawatt, die Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Der Ertrag wird auf jährlich rund 900 Tonnen grünen Wasserstoff prognostiziert. Gut die Hälfte davon steht nunmehr per Versteigerung zum Verkauf. Der Strom dafür stamme den Angaben zufolge insbesondere aus den unternehmenseigenen Windparks. „Mit 500 Tonnen Wasserstoff lassen sich rund 5.000 Tonnen grüner Stahl herstellen, der Kraftstoff für H2-Busse oder Lkw für rund fünf Millionen Kilometer bereitstellen oder 2.500 Tonnen grünes Methanol produzieren“, heißt es in einer Mitteilung. „Mit dieser Auktion setzen wir ein klares Zeichen für den Beginn einer neuen Ära in der Energieversorgung“, sagt Thomas Barkmann, Leiter des Bereichs H2-Vertrieb bei Enertrag. Das Unternehmen entwickele Wasserstoffanlagen an zahlreichen weiteren Standorten entlang des H2-Kernnetzes. So entstünden in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zwei neue Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolyseleistung von insgesamt 185 Megawatt. Der Ertrag ab 2028 liege jährlich bei kumuliert 17.000 Tonnen. Weitere Informationen zur Auktion können per E-Mail an wasserstoff@enertrag.com erfragt werden.
+++++

Kraft-Wärme-Kopplungsanlage von Övik Energi im High Coast Innovation Park. © Övik Energi AB
(Schweden) Liquid Wind AB, Entwickler von eFuel-Anlagen, soll in enger Zusammenarbeit mit dem Stromversorger Övik Energi AB eine der den Angaben zufolge „größten Anlagen für die Herstellung von eFuels in Europa“ bauen. Die Fabrik ist für eine Jahreskapazität von 100.000 Tonnen eMethanol ausgelegt. Standort ist Örnsköldsvik, Start sei Frühjahr 2025. Das Unternehmen will insgesamt zehn Projekte bis 2027 entwickeln. Liquid Wind wird gestützt von Investoren wie Alfa Laval, Carbon Clean, Elyse Energy, HYCAP, Samsung Venture Investment, Siemens Energy, Topsoe und Uniper. „Wir sehen eine große Nachfrage für den Umstieg auf nachhaltige Kraftstoffe“, sagt Claes Fredriksson, CEO und Gründer.
+++++

Bologna und Ferrara bekommen 137 Wasserstoffbusse des Typs „Urbino 12“ von Solaris, die ersten wurden nun ausgeliefert. © Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
(Italien) Der polnische Fahrzeugbauer Solaris Bus & Coach hat eigenen Angaben zufolge 37 von 137 bestellten Wasserstoffbussen nach Bologna und Ferrara in Italien geliefert. Dies sei die erste Phase des Großauftrags, den der Verkehrsbetrieb TPER in der Region Emilia-Romagna Ende 2023 erteilt hatte. Die Fahrzeuge des Typs „Urbino 12“ beziehen den Wasserstoff für die 70 Kilowatt leistende Brennstoffzelle aus fünf auf dem Dach montierten Tanks mit einer Gesamtkapazität von 37,5 Kilogramm. Die Flotte in Bologna ist in zwei Versionen konfiguriert: 70 dreitürige Fahrzeuge für städtische Strecken und 67 zweitürige für Stadt- und Vorortlinien, die die Städte mit dem Ballungsraum verbinden.
+++++

Die Bielefelder Verkehrsbetriebe haben die ersten „eCitaro Fuelcell“ von Mercedes-Benz erhalten (v.l.): Arne Petersen, Ralf Schönenberg, Dominic Hallau, Rainer Müller, Wiebke Esdar, Martin Uekmann und Oliver Hoch. © Stadtwerke Bielefeld
(Deutschland) Das Bielefelder Verkehrsunternehmen „Mobiel“ hat die ersten neuen „eCitaro Fuelcell“-Busse von Mercedes-Benz übernommen. Damit könnten in den kommenden Wochen bereits neun der Fahrzeuge im regulären Betrieb eingesetzt werden, teilte das Unternehmen mit. Der aktuelle Fuhrpark umfasse 132 Fahrzeuge, von denen 29 künftig mit Wasserstoff betrieben würden. Seit Mitte 2022 sind vier Fahrzeuge im Testbetrieb unterwegs. Die neuen Fahrzeuge könnten sowohl mit Wasserstoff als auch mit Strom betrieben werden. Durch den größeren Akku hätten die Busse generell eine größere Reichweite und könnten auch vollelektrisch fahren, wenn kein Wasserstoff zur Verfügung stehen sollte. Insgesamt werden 25 geliefert, davon acht 12-Meter-Busse und siebzehn 18-Meter-Busse (Gelenkbusse) mit 34 sowie 46 Sitzplätzen. Auf dem Dach sind Brennstoffzellen von Toyota verbaut. Die ebenfalls auf dem Dach untergebrachten Wasserstofftanks können 25 beziehungsweise 30 Kilogramm Wasserstoff aufnehmen. Die Reichweite mit Batteriekapazitäten von 300 sowie 400 Kilowattstunden liege bei mehr als 400 Kilometern. Die bereits eingetroffenen neun Gelenkbusse werden nach Testfahrten ab Anfang März in den regulären Linienbetrieb gehen, die restlichen würden noch im ersten Halbjahr geliefert. Mobiel hat eigenen Angaben zufolge selber gut zehn Millionen Euro investiert, hinzu kamen Fördermittel des Bundesverkehrsministeriums in Höhe von 8,7 Millionen Euro. Es gebe auf dem Betriebshof bereits eine Wasserstofftankstelle und eine Abstellhalle mit Werkstatt, in den kommenden Monaten folge eine weitere Abstellhalle mit besonders leistungsfähigen Ladestationen, außerdem sei ein Elektrolyseur in Planung.
+++++
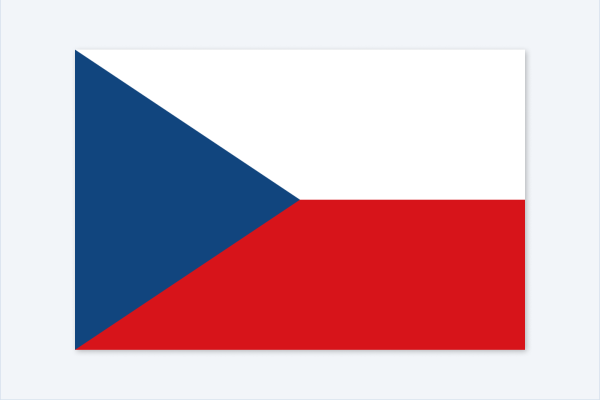
Tschechien fördert den Bau von Elektrolyseuren und Speichern. © EU-Kommission
(Tschechien) Ein neues Förderprogramm soll den Bau von Elektrolyseuren beschleunigen. Nach Angaben von Germany Trade & Invest (GTAI) stehen in einer ersten Ausschreibungsrunde rund 120 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden demnach neue Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff sowie Anlagen zur Wasserstoffspeicherung. Die Förderquote betrage bis zu 65 Prozent für den Aufbau der H2-Produktion und bis zu 55 Prozent für Speichertechnologie. Das Ministerium für Industrie und Handel (MPO) hatte im Sommer 2024 Tschechiens Wasserstoffstrategie aktualisiert. Demnach sollen bis 2030 jährlich rund 20.000 Tonnen grüner Wasserstoff im Land produziert werden. Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft erfolge in drei Etappen. Dabei konzentriere sich die erste Phase auf die ehemaligen Kohleregionen Karlovy Vary, Ústí nad Labem und Mährisch-Schlesien. Ein Drittel der Projektmittel sei laut GTAI dafür vorgesehen. Anträge können bis zum 30. Juni 2025 eingereicht werden. Die Marketingagentur Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) ist Eigentum des Bundes und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zugeordnet.
+++++

Entwicklung verschoben: Das Konzept eines weltweit ersten klimaneutralen, emissionsfreien Verkehrsflugzeugs mit Wasserstoffantrieb sollte bis 2035 umgesetzt sein, hieß es im Jahr 2020. © Airbus
(Frankreich) Medienberichten zufolge verschiebt der Luftfahrtkonzern Airbus die Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen. Grund sei, dass „die Technologie langsamer als erwartet vorangekommt“, so der NDR unter Berufung auf das Unternehmen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern hatte 2020 drei Konzepte für mit Wasserstoff betriebene Verkehrsflugzeuge vorgestellt (wir berichteten). Seinerzeit hielt Airbus-CEO Guillaume Faury seinen „ZEROe“ genannten Ansatz für „außerordentlich vielversprechend“ und sah darin „wahrscheinlich eine Lösung für die Luft- und Raumfahrt und viele andere Industriezweige“, um ihre Klimaziele zu erreichen. Demnach hätte emissionsfreies Fliegen mit Wasserstoff im Jahr 2035 möglich sein sollen.
+++++

Rendering eines „SMR-300“ von Holtec International (USA). Die Tochter Holtec Britain hat im Sommer 2024 den ersten Teil eines Genehmigungsverfahrens (Generic Design Assessment-Prozesses, GDA) für den 300-Megawatt-Reaktortyp durchlaufen, wonach dieser gemäß den in Großbritannien geforderten Sicherheits-, Sicherungs- und Umweltschutzstandards gebaut und betrieben werden könne. Dies bestätige, dass Holtec Britain qualifiziert sei, um große Kernkraftprojekte im Vereinigten Königreich durchzuführen. © Holtec International
(Großbritannien) Der britische Kernkraft-Consultant Equilibrion Ltd soll untersuchen, wie Atomstrom für die Wasserstoffproduktion genutzt und der „Low Carbon“-Energieträger dann in die Gasnetze eingespeist werden könne. Auftraggeber sind die beiden Gasverteilnetzbetreiber Northern Gas Networks Holding Ltd. (NGN) und Wales & West Utilities (WWU) mit Unterstützung des Energy Innovation Centre (EIC), einem Zusammenschluss von neun britischen Energiekonzernen. Die „ShyNE“ (Study on Hydrogen Nuclear Energy) genannte Untersuchung soll entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch potenzielle neue Standorte für AKW lokalisieren – insbesondere für neue kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR) und fortgeschrittene modulare Reaktoren (Advanced Modular Reactors, AMR) – sowie Infrastrukturen, Nachfragezentren und Finanzierung analysieren. Überdies werde untersucht, inwiefern Kernkraftwerke in Kombination mit Wasserstoffproduktion netzdienlich sind, mithin die Stromnetze stabilisieren können.
+++++

Die BP-Raffinerie in Lingen soll durch eine Wasserstoffproduktion mit einer Leistung von 100 Megawatt ergänzt werden. © BP Europe SE
(Deutschland) Das US-Unternehmen Cummins Inc. wird ein 100 Megawatt (MW) leistendes Protonenaustauschmembran-Elektrolyseursystem (PEM) für das Lingener Wasserstoffprojekt von BP in Norddeutschland liefern. Der Ertrag der dafür vorgesehenen 20 Einheiten des Typs „HyLYZER-1000“ wird auf jährlich 11.000 Tonnen prognostiziert, der Strom stammt aus Offshore-Windkraftanlagen. Der Standort soll später an das Wasserstoffkernnetz angebunden werden. Vertragspartner ist der Cummins-Geschäftsbereich Accelera. Die Elektrolyseure werden im spanischen Guadalajara hergestellt, wo das Unternehmen im April vergangenen Jahres eine PEM-Fabrik mit einer Jahreskapazität von 500 Megawatt in Betrieb genommen hatte. BP Europe SE hatte die endgültige Investitionsentscheidung für sein 100-Megawatt-Projekt „Lingen Green Hydrogen“ (LGH2) Ende letzten Jahres getroffen (wir berichteten). Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.
+++++

Visualisierung Statkraft-Standort Emden. Der Konzern will dort grünen Wasserstoff produzieren. © Statkraft
(Deutschland) Der staatliche norwegische Energiekonzern Statkraft hat die Friedrich Vorwerk Group SE mit der Detailplanung von zwei Anlagen für die Herstellung von grünem Wasserstoff in Emden beauftragt. Der vorerst auf eine Leistung von zehn Megawatt ausgelegte Elektrolyseur soll mittelfristig auf 200 Megawatt (MW) erweitert werden. Statkraft verhandelt eigenen Angaben zufolge derzeit über eine Zuwendung in Höhe von 107 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds. Ab 2030 sollen bis zu 20.000 Tonnen grüner Wasserstoff über das Kernnetz an die deutsche Industrie geliefert werden und überdies Kunden in Emden grüne Fernwärme mittels eines Wärmepumpensystems beziehen können. Statkraft habe im Jahr 2024 über 1.000 MW an neuen Projektrechten für Solar- und Windkraftanlagen akquiriert, bilanzierte das Unternehmen im Rahmen der diesjährigen Messe „E-World Energy & Water“. Damit umfasse die Unternehmenspipeline nun über 2.500 MW an gesicherten Projektrechten, wovon 1.600 MW auf Windprojekte fielen.
+++++
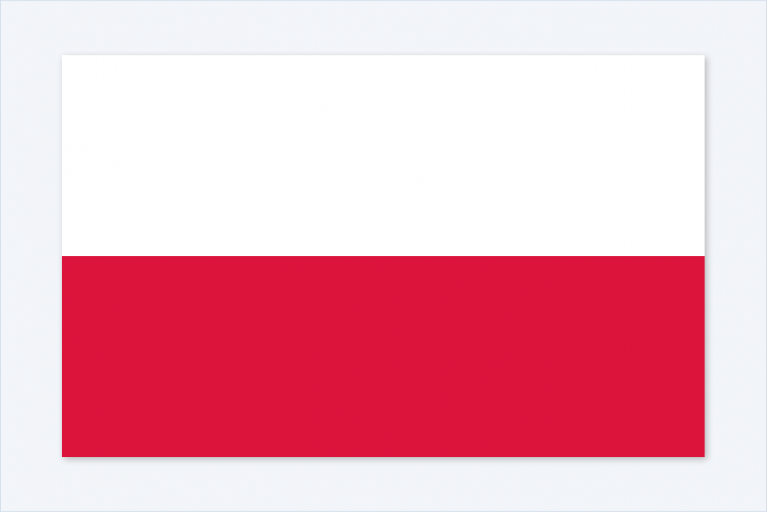
Polen fördert Wasserstoffprojekt und PV- sowie Windkraftanlagen, wenn der Ertrag zur H2-Produktion genutzt wird. © EU-Kommission
(Polen) Die staatliche Förderbank BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) stellt insgesamt 640 Millionen Euro für Wasserstoffprojekte bereit. „Die Zuschüsse richten sich an Unternehmen, die emissionsarmen oder emissionsfreien Wasserstoff produzieren wollen“, heißt es in einer Mitteilung der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI). Firmen könnten mit den Geldern neue Elektrolyseure ab einer Leistung von 20 Megawatt finanzieren, wobei der beantragte Zuschuss bei unter zwei Millionen Euro je Megawatt liegen müsse. Förderung bekämen auch Solaranlagen und Windkraftanlagen, solange der erzeugte Strom in die Wasserstoffproduktion fließe. Die Mittel stammen aus dem Wiederaufbaufonds der EU. Die BGK nimmt ausweislich der Website Anträge bis zum 28. Februar 2025 entgegen. Die Unterzeichnung der Förderzusagen werde demnach für Juni erwartet. Die Marketingagentur Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) ist Eigentum des Bundes und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zugeordnet.
+++++

Rheinmetall liefert Kühlpumpen für Brennstoffzellenanwendungen nach Asien. © Rheinmetall
(Deutschland) Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von einem namentlich nicht genannten „Neukunden“ aus Asien den Auftrag zur Lieferung einer „Hochvolt-Kühlmittelpumpe CWA2000“ für den Einsatz in einer 800-V-Brennstoffzellen-Architektur erhalten. Anwendungsgebiete seien etwa Kleintransporter, Lkw, aber auch stationäre Kraftwerke. Das Auftragsvolumen für eine „niedrige sechsstellige Stückzahl“ beträgt nach Unternehmensangaben mehr als 26 Millionen Euro. Die Pumpe sei als Nassläufer ausgelegt und „praktisch verschleißfrei“. Die Produktion starte im Jahr 2027 im Werk in Hartha (Sachsen) und laufe bis 2031. Die 800-Volt-Technik biete einen „höheren Alltagsnutzen und eine doppelte Ladeleistung gegenüber dem 400-Volt-Spannungsniveau“, da die elektrischen Verluste verringert würden. Die Technik erlaube die Verwendung dünnerer Leitungen und damit Einsparungen beim Bauraum, beim Gewicht und bei Edelmetallen, etwa Kupfer. Durch die geringere Verlustwärme könne zudem das Kühlsystem kleiner und dennoch effizienter ausfallen. Der Auftrag sei „von strategischer Bedeutung, da Rheinmetall hiermit seinen Fußabdruck auf dem wichtigen asiatischen Markt für Komponenten für Antriebssysteme in zukünftigen Elektrofahrzeugen vertiefen“ könne.
+++++
Foto oben
iStock / © Danil Melekhin






